Status quo: Kleinspeicher arbeiten ineffizient
Mit einem Balkonkraftwerk und Speicher speicherst du tagsüber Strom und nutzt ihn dann, wenn die Sonne nicht mehr scheint - optimal, um den Eigenverbrauch zu erhöhen und Stromkosten zu sparen. Aber da die Mini-Solaranlage die erzeuge Solarenergie direkt ins Hausnetz einspeist, kommt der kleine Speicher häufig gar nicht erst zum Einsatz - insbesondere an sonnenarmen Tagen. Schätzungen zeigen, dass Kleinspeicher bis zu 70 % der Zeit quasi brach liegen. Das ist nicht besonders effizient.
Unabhängig von der Solaranlage könnte man die Speicherbatterie einsetzen, um Strom aus dem Hausnetz zu laden, wenn er günstig ist. Und dann zu nutzen, wenn die Strompreise hoch sind. Hierdurch würde man nicht nur mehr Stromkosten und CO2-Emissionen sparen, sondern zu einer höheren Netztdienlichkeit bzw. -stabilität beitragen. Denn nutzt man den gespeicherten Strom zu einer Zeit mit einer allgemein hohen Auslastung, entlastet man das Stromnetz, wodurch die Stromversorgung insgesamt weiter steigen kann.
Um dies zu ermöglichen, müssten Politik und Netzbetreiber den rechtlichen Rahmen anpassen. Der Verein BalkonSolar e.V. stellt hierzu mit einer Petition klare Forderungen an die Politik und bietet gleichzeitig die passenden Lösungen an.
Das Problem: Abregelung erneuerbarer Energien
Derzeit stehen die Kleinspeicher noch vor Hürden unterschiedlicher Natur, die dazu führen, dass erneuerbare Energien nicht genutzt, sondern abgeregelt bzw. begrenzt werden. Nachfolgend die Hindernisse zusammengefasst.
Komplizierte Regeln
Kleinspeicher (oft nur 2–4 kWh) werden bislang behandelt wie große Hausakkus. Das bedeutet komplizierte Anmeldeverfahren und potenziell teure Zählertauschpflichten. Viele Nutzer schließen ihre Speicher deshalb informell an – ohne jede Netzdienlichkeit.
Fehlende Preissignale
Zwar bieten einige Energieversorger dynamische Stromtarife an, die Preise stündlich an Börsenkurse koppeln. Doch wenn man rund 20 % Ladeverluste einkalkuliert, machen sich die meisten Tarifsprünge nicht bezahlt. Was fehlt, sind zeit- und ortsvariable Netzentgelte, die echtes netzdienliches Laden lukrativ machen.
Mangelnder Zugriff auf Echtzeit-Daten
Um zu entscheiden, wann Laden und Entladen sinnvoll ist, brauchen Speicher stündliche oder gar minutenschnelle Verbrauchsdaten. Doch das heutige Messwesen blockiert diese Möglichkeiten oft: Der Rollout von Smart Metern kommt nur schleppend voran, und vorhandene Infrarotschnittstellen werden nicht anerkannt, obwohl sie schnelle Datenauslese erlauben.
Eine Lösung: Variable Netzentgelte
Dabei könnte es so einfach sein, wenn Politik und Netzbetreiber den rechtlichen Rahmen ändern. Ein wichtiger Punkt: Variable Netzentgelte. Die Idee ist simpel: Man zahlt nicht immer dieselbe Netzgebühr, sondern richtet sie nach der lokalen und zeitlichen Netzbelastung. So wird das Laden bei niedriger Auslastung und günstigen Preisen belohnt, während das Entladen zu Spitzenzeiten das Stromnetz stabilisiert und den eigenen Geldbeutel schont.
Welche Vorteile hätte das konkret?
- Höhere Ersparnis: Simulationsrechnungen zeigen, dass bei netzdienlichem Betrieb jährlich mehrere Hundert Euro mehr gespart werden können.
- Weniger CO₂: Wenn viele Mini-Akkus Strom aus Solarenergie speichern und abends abgeben, müssen weniger fossile Kraftwerke einspringen.
- Geringerer Netzausbau: Wenn Millionen kleiner Speicher Lastspitzen abfedern, müssen Leitungen weniger stark ausgebaut werden – ein enormer Kostenvorteil für alle.
Wo hakt es noch?
- Smart-Meter-Rollout: Der flächendeckende Einbau intelligenter Stromzähler verläuft schleppend. Und selbst wer ein Smart Meter hat, kann häufig nicht in Echtzeit an die Daten.
- Bürokratie abbauen: Kleine Speicher (2–4 kWh) an der Steckdose sollten sich so einfach anmelden lassen wie Balkonkraftwerke. Aktuell aber sind die Hürden hoch.
- Offene Schnittstellen: Die Infrarot-Schnittstelle vieler Zähler wird nicht anerkannt. Dabei ließe sich damit der Verbrauch schnell und einfach messen.
Der Balkonkraftwerk-Spezialist Andreas Schmitz (Der Akku Doktor) geht detailliert auf die einzelnen Punkte in folgendem Video ein:
Inhalte der Petition
Die am 13. 02. 2025 gestartete Petition „Netzdienliche Zwischenspeicherung erneuerbarer Energien durch Kleinspeicher“ weist darauf hin, dass Kleinspeicher rasch und kostengünstig installiert werden können und damit sofort helfen, erneuerbaren Strom besser zu nutzen. Um das zu ermöglichen, fordert sie vier zentrale Schritte:
Nutzen statt Abregeln
Variable Netzentgelte (wie bei Wallboxen oder Wärmepumpen) sollen für Kleinspeicher geöffnet werden – auch ohne eigene PV-Anlage. Nur so lohnt es sich, überschüssige Erzeugung aus dem Netz zu ziehen, statt Wind- oder Solarstrom abzuschalten.
Smart-Meter-Light-Lösungen
Für Haushalte mit niedrigem Verbrauch oder ohne steuerbare Großverbraucher ist ein „klassisches“ Smart-Meter-Gateway oft zu teuer und überdimensioniert. Eine moderne Messeinrichtung mit vereinfachter Datenerfassung reicht hier völlig aus („Smart Meter light“) und würde den Rollout beschleunigen.
Regulatorische Gleichstellung mit Steckersolargeräten
Steckerfertige Kleinspeicher – ob mit oder ohne Mini-PV – sollten unkompliziert anmeldbar sein. Wie bei Balkonkraftwerken braucht es klare, schlanke Regeln statt aufwendiger Zähler- und Meldepflichten.
Strompreis-Transparenz
Netzentgelte, Steuern, Umlagen und Börsenpreise müssen zentral, automatisiert und in Echtzeit abrufbar sein (z. B. über smard.de). Nur so können Kleinspeicher intelligent und netzdienlich gesteuert werden. Einheitliche API-Schnittstellen bei dynamischen Tarifanbietern erleichtern zusätzlich die automatisierte Nutzung.
Erste Erfolge & Ausblick
Bereits jetzt zeigt sich politisches Interesse: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Initiatoren angehört, und frühere Petitionen zum Thema Steckersolargeräte wurden fast vollständig in gesetzliche Regelungen übernommen. Bei Erreichen von 30.000 Unterschriften wird auch diese neue Petition im Bundestag behandelt.
Fazit
Kleinspeicher sind das fehlende Puzzle-Stück zwischen Netzausbau und echter Versorgungssicherheit. Sie können im Verteilnetz lokal Lastspitzen abfangen und erneuerbaren Strom verfügbar machen, wenn er gebraucht wird. Was es dafür braucht, ist weniger Bürokratie, mehr Transparenz und passende Anreize. Wer jetzt unterschreibt, macht den Weg frei, damit Millionen kleiner Akkus endlich ihren vollen Beitrag zur Energiewende leisten können.
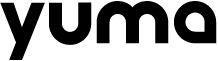



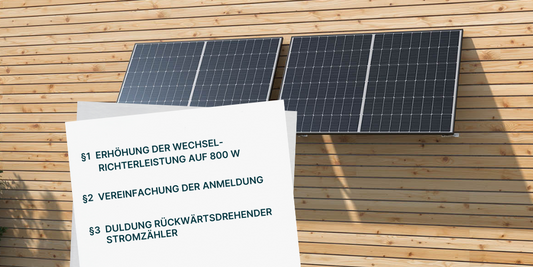


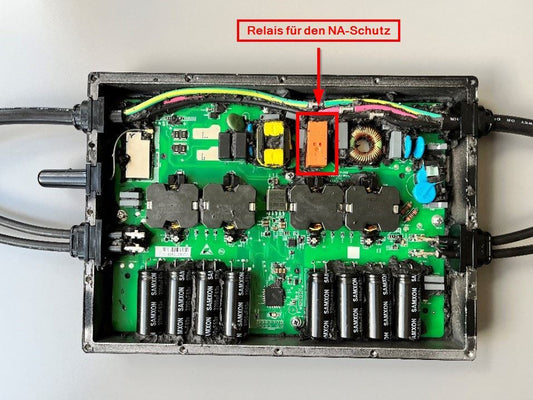
































 Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement
Beispiel AnkerIntelligence-App, sogar mit KI-basiertem Energiemanagement
